Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt. Heft 86. Neue Folge Heft 33.
Heft 86 (2025) der „Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt“ wartet in bewährter Weise mit interessanten Themen aus der Erfurter Stadtgeschichte auf: Insgesamt 14 Beiträge in Form von Miszellen, Aufsätzen, Rezensionen und Berichten laden ein, sich mit der Vergangenheit von Erfurt und seiner Region zu befassen. Dabei stets im Mittelpunkt: der Verein, der seine wichtige Funktion als „historisches Gewissen der Stadt“ wahrnimmt.
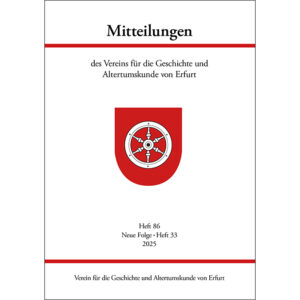
Jetzt erhältlich in unserem Shop
Den Auftakt macht ein Miszellen-Beitrag von Steffen Raßloff zur Person des Garten- und Landschaftsarchitekten Reinhold Lingner, der für diverse renommierte Bauprojekte in der DDR verantwortlich zeichnete. Zu seinen Großprojekten gehörten etwa die KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Sachsenhausen, das „Stadion der Weltjugend“ in Berlin sowie die erste Internationale Gartenausstellung „iga“ 1961 in Erfurt. Für seine Leistungen wird er mit einem biografischen Eintrag in der Datenbank der Neuen Deutschen Biografie (NDB) geehrt.
Von Architektur, Theologie und goldenen Zeptern
Die anschließende Aufsatzsammlung beginnt mit einem Einblick in die romanische Kirchenarchitektur des 12. Jahrhunderts, gefolgt von einer Forschungsarbeit zur Einwohnerzahl Erfurts im Spätmittelalter, die ausgehend vom vorhandenen Quellenmaterial bisherige Angaben neu bewertet. Im Zentrum des nächsten Beitrages steht der theologische Traktat „De quattuor instinctibus“, die Schrift befasst sich mit der Lehre von der „Unterscheidung der Geister“, also der Beurteilung, ob Aussagen eines Menschen göttlichen, engelhaften, natürlichen oder teuflischen Ursprungs sind. Darauf folgt eine Auseinandersetzung mit den sogenannten „Berliner“ Zeptern, goldenen Universitätsinsignien, die im Erfurter Stadtmuseum ausgestellt sind und durch ihre Geschichte die Universitäten Erfurt, Berlin und Prag verbinden. Im nächsten Aufsatz wird zum Wirken des Baumeisters Arnold von Westfalen im spätmittelalterlichen Erfurt geforscht. Danach geht es um die Rolle der Asymmetrie als baulichem Prinzip in gotischen Pfarrkirchen Erfurts, insbesondere St. Ägidius.
Von Bauernkriegen, Bauplänen und einem jüdischen Künstler
Anlässlich des 500-jährigen Jubiläums der Erstürmung des Tonndorfer Schlosses im Bauernkrieg 1525 ist ein weiterer Beitrag den damaligen Ereignissen und den dazugehörigen Quellen gewidmet. Mit Quellenforschung geht es weiter, wenn zwei bisher unveröffentlichte Grundrisspläne der Erfurter Reglerkirche aus dem 17. und 18. Jahrhundert erstmals publiziert und analysiert werden. Besonderes Augenmerk gilt den anhand dieser Pläne belegbaren Begräbnissen in der Kirche. Danach wird eine Persönlichkeit neu ins Rampenlicht gerückt, die in Erfurt in den letzten Jahren relativ wenig beachtet wurde, obwohl sie nicht nur kunsthistorisch interessant ist: der Maler und Kunstwissenschaftler Manasse Unger, der im 19. Jahrhundert mit seiner jüdischen Familie nach Erfurt kam. Die Persönlichkeit und das bewegte Leben Manasse Ungers, dessen Ausbildung und Wirken ihn nach Berlin, Italien und Wien führte, ist nicht nur durch Schriften seiner Zeitgenossen, sondern auch aus seinem autobiographischen Werk „Semida’s Kinderjahre“ greifbar, in dem er das Leben seiner Familie in seiner Kindheit beschreibt. In Berlin gehörte Manasse Unger unter anderem zum sogenannten „bewaffneten Künstler-Corps“, das in den revolutionären Unruhen 1848 gegen die Regierung protestierte.
Rückblicke auf das Jahr 2024
Dem umfangreichen Aufsatzteil folgen der stadtarchäologische Bericht, verschiedene Rezensionen, ein Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr und die Chronik der Stadt Erfurt 2024.
„Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt. Heft 86. Neue Folge Heft 33.“, ist erschienen im Verlag PH.C.W. SCHMIDT aus Neustadt an der Aisch, ISBN 978-3-87707-343-8, Ladenpreis 20,00 €.